

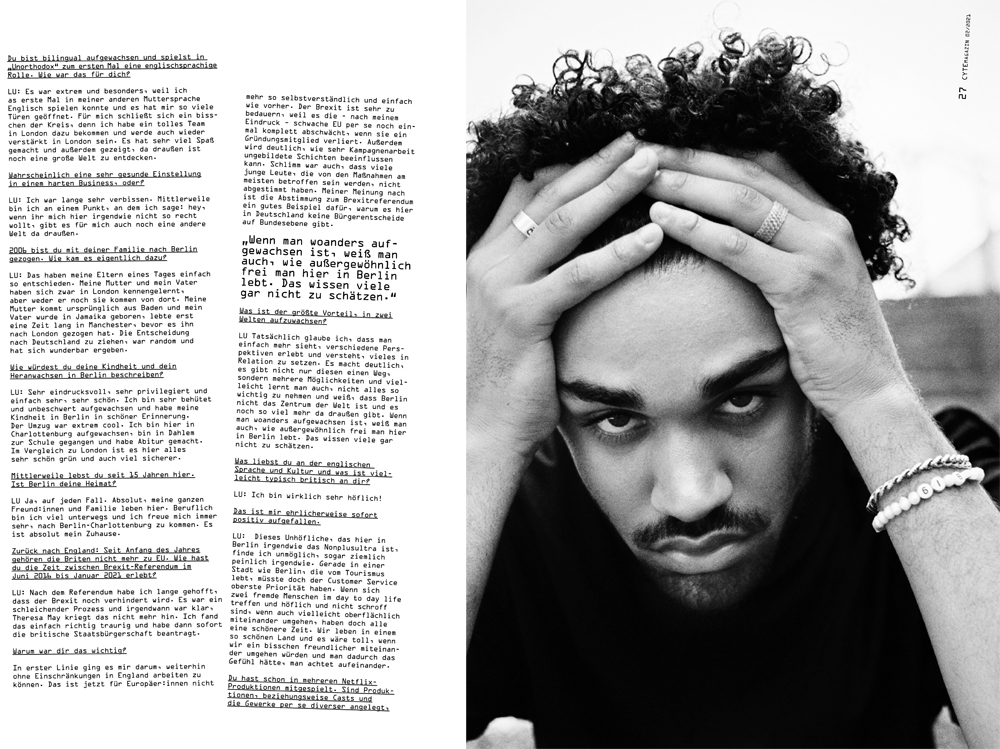

Langston Uibel
- Juni. 2021
Berlin, Savignyplatz
Langston Uibel (23) ist nicht nur Schauspieler, sondern auch politisch aktiv. Im Interview verrät der gebürtige Londoner, warum sich jeder Mensch engagieren sollte, warum es bisher nicht einen einzigen Tag in seinem Leben ohne Musik gab und warum der Autodidakt Angst vor Schauspielunterricht hat. Zu sehen gibt es natürlich auch etwas von ihm: In seiner vierten Netflix Kollaboration stößt er zum Hauptcast von „How To Sell Drugs Online (Fast)“ dazu.
Viele deiner Schauspielkolleg*innen führen äußerst ungern Interviews mit Journalist*innen. Hast du eine Ahnung, woran das liegen könnte?
LU: Viele Schauspieler*innen, die ich kenne und schätze, sind nicht unbedingt so krass extrovertierte Menschen, die sich immer in den Mittelpunkt stellen wollen. Ich finde es auch immer wieder challenging, aber natürlich weiß ich auch, wie wichtig PR im Rahmen einer Veröffentlichung ist.
Dir dagegen ist es wichtig, auch abseits von obligatorischen PR-Terminen die Stimme gegen Rassismus und für mehr Chancengleichheit zu erheben. Warum ist dir das ein Anliegen?
LU: Mein Engagement ist völlig unabhängig vom Beruf. Ich glaube, egal was ich beruflich mache, ich würde immer meine eigene Meinung haben und auch darüber sprechen. Ich bin ein politischer Mensch und ich würde mir wünschen, dass sich noch viel mehr Menschen politisch engagieren. Jeder Mensch sollte für eine persönliche Sache einstehen, denn davon lebt Demokratie und je mehr Menschen sich beteiligen, desto besser ist es für die Gesellschaft, in der wir leben.
„Erfahrungswerte über Rassismus, die man als schwarze Person in diesem Land gemacht hat, wurden null ernst genommen. Eigentlich wurden Diskussionen immer weggeschoben. Nach dem Motto: Rassismus gibt’s, aber hier ist doch alles nicht so dramatisch. Deswegen war es für mir auch so enorm wichtig, auf dieser Demo zu sprechen.“
Du warst bei der Black Lives Matter-Bewegung in Berlin aktiv und hast auch bei der Demonstration im Juni 2020 am Berliner Alexanderplatz gesprochen. Welche Bedeutung hat dieser Tag für dich?
LU: Für mich war dieser Tag wie das Ende einer Reise, die man in diesem Land durchgemacht hat und gleichzeitig auch eine kleine Zäsur. Durch meinen Vater wurde ich stark politisiert und war schon lange sehr, sehr politisch und auch immer schon sehr „aware“, was es bedeutet, schwarz in dieser Welt zu sein. Außerdem fanden viele Diskussionen, die wir heute in Deutschland führen, schon um einiges früher in England statt, wo ich die ersten Jahre meiner Kindheit verbrachte. Während meines Aufwachsens in Berlin und in Deutschland bin ich dann sehr oft an meine Grenzen gestoßen, wenn ich über Rassismus sprechen wollte. Ob in der Schule, im Arbeitskontext oder im privaten Kontext. Erfahrungswerte über Rassismus, die man als schwarze Person in diesem Land gemacht hat, wurden null ernst genommen. Eigentlich wurden Diskussionen immer weggeschoben. Nach dem Motto: Rassismus gibt’s, aber hier ist doch alles nicht so dramatisch. Deswegen war es für mir auch so enorm wichtig, auf dieser Demo zu sprechen. In erster Linie habe ich natürlich zu anderen schwarzen Deutschen gesprochen, weil ab diesem Punkt, also an diesem Tag klar war, auch in diesem Land geht eine Diskussion über strukturellen Rassismus und Polizeigewalt los. Die anschließende gesellschaftliche Debatte hat mich persönlich dann aber verstummen lassen, weil ich erst lernen musste damit umzugehen, dass auf einmal alle über „einen“, also die Eigenschaft schwarz zu sein sprechen und merkte, krass, jetzt verstehen die Leute das erst. Mich hat die gesamtgesellschaftliche Diskussion über Rassismus auch verunsichert.
(O-Ton LU auf der Demo: „Ich habe Berlin noch nie so schön gesehen. Vielen Dank, dass ihr hier seid.“)
Hast du eine Erklärung dafür, warum der Tod eines Schwarzen in Amerika solche Auswirkungen in Deutschland hatte?
LU: Ich denke es liegt daran, weil es in erster Linie sehr bequem ist, auf eine Tat weit weg in Amerika zu verweisen. So kann man sich, auch wenn die Diskussion importiert wurde, immer noch ein wenig distanzieren. Den Hashtag #blacklivesmatter finde ich teilweise irreführend, weil damit eine Bewegung, die in Amerika losgetreten worden ist, gemeint ist, es aber um die alltägliche Lebensrealität von schwarzen Menschen auf der Welt geht, auch in Deutschland. Es ist ein ständiges Thema, für das grundsätzlich sensibilisiert werden muss und was nicht einfach beendet oder gelöst werden kann, sondern das tiefgehend und intersektional betrachtet werden muss. Damit möchte ich nicht sagen, dass es keine Chance auf Verbesserung gibt, aber es eben nicht einfach und vor allem nicht schnell zu lösen ist.
Es gibt einen Ausschnitt im Netz, da sieht man dich gemeinsam mit Hadnet Tesfai auf der Bühne. Ihr lest die Namen von getöteten schwarzen Menschen aus Deutschland vor. Welche Botschaft wolltet ihr damit senden?
Damit wollten wir zeigen, dass Polizeigewalt eben nicht nur ein Problem in Amerika ist, sondern Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe auch bereits in Deutschland umgebracht worden sind. Vor einiger Zeit haben alle Parteien außer die Linke dafür gestimmt, einen Schlussstrich unter die parlamentarische Aufarbeitung der Todesumstände von Oury Jalloh zu ziehen. (Anm. Red. 2005 verbrannte Oury Jalloh unter nach wie vor nicht vollständig rekonstruierten Umständen in einer Dessauer Arrestzelle) Auch wir haben Probleme mit Rassismus bei der Polizei und auch bei der Bundeswehr. Das sind tiefgreifende Probleme und somit deutsche Probleme.
Der Tod von George Floyd hat sich im Mai zum ersten Mal gejährt. Welche konkreten Auswirkungen hat die Black Lives Matter-Bewegung auf die deutsche Filmbranche? Kann man das heute schon absehen?
LU: Ich würde schon sagen, dass auch in der Filmbranche ein Wandel stattfindet, aber ich glaube, es ist noch zu früh, um zu beurteilen, ob es ein nachhaltiger Wandel ist. Ich hoffe es natürlich sehr. Man kann sich relativ schnell bekannte Schauspielerinnen of Color nehmen und in der Produktion platzieren, aber das ist noch kein Beleg dafür, dass wirklich ein Umdenken greift. Tiefgreifender Wandel passiert auch hinter der Kamera, auf Produktionsebene, da muss in Zukunft noch genauer hingeschaut werden. Also mal schauen, was mittelfristig passiert und inwieweit Schwarze, aber beispielsweise auch lesbische Frauen besetzt werden.
Gab es jemals die Situation, in der du dich gefragt hast, warum du beim Casting nicht reüssierst? Dachtest du schon einmal, dass es an deiner Hautfarbe liegt?
LU: Die politische Ebene einer Besetzung kann ich von meinem Standpunkt aus nicht bewerten Warum man eine Rolle nicht bekommt, kann ganz unterschiedliche Gründe haben.
Welche persönlichen Erfahrungen mit Alltagsrassismus hast du als Kind oder junger Heranwachsender gemacht, die heute noch nachwirken?
LU: Da gibt es genügend Beispiele, bei denen Verletzendes hängengeblieben ist. Und ich habe wenig Lust, irgendetwas davon zu reproduzieren.
Du bist 23 Jahre alt und gehörst fast zu der Generation der Digital Natives. Welche Rolle spielen Soziale Medien bei der Mobilisierung der Bewegung?
- Auf der digitalen Ebene bin ich eher ein stiller Beobachter als jemand, der seinen Alltag postet. Ich bin `98 geboren, kenne also noch eine Welt und Kindheit ohne Social Media. Ich hatte erst mit 12 Jahren ein Smartphone. Ich sehe die Digitalisierung und alles was damit zusammenhängt auch eher positiv als negativ und finde auf Twitter oft Dinge wirklich sehr witzig. Ich habe einen sehr internationalen Freundeskreis und bin mit vielen Freunden in Amerika und England vernetzt. Außerdem konsumiere ich britische und amerikanische Medien, das ist schon sehr cool. Als ich noch zur Schule gegangen bin, wurden vor allem Handys oft verteufelt und es hieß immer, bloß keine Handys, Handys, Handys. Logisch, der Umgang damit muss gelernt werden, aber ist es nicht auch ein bisschen witzig, dass heute gerade die Generation auf Fake News reinfallen und Hasskommentare schreiben, die vorher gewarnt haben, dass daran alles schlecht ist? Für mich haben Nachrichten im Fernsehen und die gedruckte Zeitung immer noch einen höheren Stellenwert, als Dinge, die ich in meine Timeline gespült bekomme.
„Deswegen reicht es nicht, einfach nur jemanden mit der gewissen Hautfarbe oder Geschlecht an einer erfolgreichen Stelle zu positionieren, wenn diese Person sich nicht für Menschen mit bestimmten Eigenschaften einsetzt.“
Lass uns über dich und deine Anfänge als Schauspieler reden: Als Zehnjähriger standest du 2008 zum ersten Mal vor der Kamera. Hattest du als Kind und junger Schauspieler Vorbilder oder gab es jemanden, an dem du dich orientiert hast?
LU Tatsächlich gar nicht. Da gab es niemanden, an dem ich mich orientiert habe. Die Frage nach Vorbildern finde ich allerdings auch heute noch schwierig zu beantworten. Es gibt natürlich viele coole Schauspieler und Schauspielerinnen da draußen, wie Maryam Zaree in Deutschland oder Lakieth Stanfield in den USA beispielsweise. Ich wünsche mir, irgendwann mit ihnen zusammen arbeiten zu können, anstatt ihnen nachzueifern oder zu ihnen aufzuschauen.
Anders gefragt: Glaubst du, dass du als junger schwarzer Schauspieler Vorbild für die nächste Generation sein könntest?
LU: Es wäre schön zu wissen, wenn ich andere jüngere schwarze Menschen positiv motivieren könnte. Wenn man sich als schwarzer Schauspieler versteht, ist Repräsentation aber nicht alles, sondern immer nur ein erster Schritt, damit ein junger Mensch sieht, dass ein Beruf auch für ihn in Frage kommt. Deswegen sind Repräsentation und Sichtbarkeit nur ein Anfang. Denn es gibt auch viele Beispiele von schwarzen Politiker*innen, schwarzen Akteur*innen oder auch Schauspieler*innen of Color, die sich trotz ihrer Hauptfarbe nicht für gleiche Rechte und Chancengleichheit für Schwarze einsetzen. Deswegen reicht es nicht, einfach nur jemanden mit der gewissen Hautfarbe oder Geschlecht an einer erfolgreichen Stelle zu positionieren, wenn diese Person sich nicht für Menschen mit bestimmten Eigenschaften einsetzt.
Gab es bisher in deiner Laufbahn positives Feedback von jungen Schwarzen, die dich als Schauspieler gesehen haben?
Ja, nach „Dogs of Berlin“ hatte ich total nette Begegnungen und habe viele Nachrichten bekommen. Da habe ich das erste Mal verstanden, was es heißt, Schauspieler einer erfolgreichen Serie zu sein. Von einem Tag auf dem anderen wurde ich in der U-Bahn erkannt und die Leute wollten Fotos mit mir machen. Das Coolste und das Schönste ist es aber natürlich, wenn dir jemand sagt: „Hey, ich hab` dich gesehen und du hast mir Kraft gegeben, auch Schauspieler:in zu werden“.
Wie bist du eigentlich Schauspieler geworden?
LU: Das war wirklich Zufall. Meine Eltern haben nichts mit Film zu tun, aber ein Freund meiner Mutter, der gerade für die Berlinale 2008 einen Kurzfilm drehte, hat zufällig ein Bild von mir gesehen und so kam ich zu meiner allerersten Rolle und habe schnell gemerkt, wie viel Spaß mir das macht.
Gab es den einen Moment in deinem Leben, indem du gemerkt hast, das will ich machen, das ist meine Berufung?
Als ich in der 10. Klasse war, habe ich zusammen mit Louis Hofmann den Film „Freistatt“ gedreht und danach haben wir gemeinsam in den ersten beiden deutschen Netflixserien mitgespielt. Damals dachte ich, okay, nach der Schule versuche ich erst einmal Schauspieler zu sein. Das war aber noch nicht so entschlossen. Erst im vergangenen Jahr als „Unorthodox“ rauskam, realisierte ich, ich bin schon an einem gewissen Punkt und es wird immer mehr. Vielleicht geht aber auch jetzt alles schief, weil ich es angenommen habe und gerade laut ausspreche (lacht).
Bis zu deinem 8. Lebensjahr bist du in London aufgewachsen. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit? Was ist dir heute noch besonders präsent?
LU Die Zeit in London habe ich ziemlich intensiv in Erinnerung. Ich bin im Süden von London, in Streatham Hill in der Nähe von Brixton, wo mein Vater einen Buchladen hatte, aufgewachsen. Bis zur dritten Klasse ging ich in England zur Schule. Die Schulzeit hat mich in vielerlei Hinsicht geprägt. Dabei meine ich nicht unbedingt Wissensvermittlung, sondern grundsätzliche Dinge, die man fürs Leben mitbekommt. Wir trugen natürlich alle Schuluniform, vertraten damit für jeden sichtbar unsere Schule nach außen und waren verpflichtet, Menschen die Hilfe brauchen, auch zu helfen. Außerdem ist die britische Gesellschaft insgesamt sehr viel mehr durch Einwanderung geprägt und multikultureller. Es sind alles Engländer, aber sie sind eben nicht alle weiß.
„Es gibt ja Menschen, die hören kaum oder wenig Musik. Wie krass das sein muss, kann ich mir gar nicht vorstellen. In meinem Leben gab es bisher nicht einen Tag ohne Musik. Ich höre eigentlich immer Musik.“
Ich habe gelesen, dass du und dein Vater einen Jazzclub in Dalston betreibt. Stammt dieser aus eurer geneisamen Familienzeit in London? Oder ist das was Neues?
Ja, den gibt es noch heute und stammt aus der Zeit, als meine Brüder im Jahre 2000 geboren worden sind. Während meines Abis bin ich regelmäßig nach London geflogen und habe am Wochenende im Jazz Club gearbeitet. Irgendwann wurde das zu zeitintensiv und ich konzentrierte mich mehr auf meine Arbeit. Mittlerweile hat mein kleiner Bruder das Sagen im Club und ist in die Geschäftsführung aufgestiegen. Ich bin aber noch unterstützend und beratend dabei.
Welche Rolle spielt Musik und Jazz in deinem Leben?
LU: Musik und gutes Essen spielen eine sehr große Rolle in meiner Familie und in meinem Leben. Zuhause haben wir viele schwarze Künstler:innen, wie zum Beispiel Etta James, gehört und bis heute prägt mich der Musikgeschmack meines Vaters sehr. Für mich gibt es für jede Lebenssituation, ob ich glücklich oder traurig bin, die passende Musik und meine Laune ist nach einem Song immer ein bisschen besser als vorher. Es gibt ja Menschen, die hören kaum oder wenig Musik. Wie krass das sein muss, kann ich mir gar nicht vorstellen. In meinem Leben gab es bisher nicht einen Tag ohne Musik. Ich höre eigentlich immer Musik.
Dann hast du sicherlich als Kind ein Instrument gelernt, oder?
LU: Ja, ich habe mal Geige gespielt, aber richtig gut war ich nie. Außerdem hatte ich oft Musikunterricht, wenn meine Mitschüler:innen in der großen Pause waren. Da hatte ich natürlich wenig Lust zu üben. Einmal habe ich meine Geige sogar in einem Sandkasten vergessen. Ganz, ganz schlimm.
In der preisgekrönten Miniserie „Unorthodox“ spielst du einen Musikstudenten aus Berlin, der Esty kennenlernt und im Orchester ist. Inwiefern waren deine Geigenkenntnisse bei der Rolle hilfreich?
LU: In der Serie spiele ich Cello, was irgendwie ein bisschen eine große Geige ist. Wir Schauspieler spielten gemeinsam in einem richtig guten Orchester und ich lernte, wie ich bei meinem Einsatz die Finger am Cello halte und bewege. Meine Saiten waren aber Gott sei Dank abgeklebt, sodass nie ein lauter Ton herauskam.
Du bist bilingual aufgewachsen und spielst in „Unorthodox“ zum ersten Mal eine englischsprachige Rolle. Wie war das für dich?
LU: Es war extrem und besonders, weil ich das erste Mal in meiner anderen Muttersprache Englisch spielen konnte und es hat mir so viele Türen geöffnet. Für mich schließt sich ein bisschen der Kreis, denn ich habe ein tolles Team in London dazu bekommen und werde auch wieder verstärkt in London sein. Es hat sehr viel Spaß gemacht und außerdem gezeigt, da draußen ist noch eine große Welt zu entdecken.
Wahrscheinlich eine sehr gesunde Einstellung in einem harten Business, oder?
LU: Ich war lange sehr verbissen. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, an dem ich sage: hey, wenn ihr mich hier irgendwie nicht so recht wollt, gibt es für mich auch noch eine andere Welt da draußen.
2006 bist du mit deiner Familie nach Berlin gezogen. Wie kam es eigentlich dazu?
LU: Das haben meine Eltern eines Tages einfach so entschieden. Meine Mutter und mein Vater haben sich zwar in London kennengelernt, aber weder er noch sie kommen von dort. Meine Mutter kommt ursprünglich aus Baden und mein Vater wurde in Jamaika geboren, lebte erst eine Zeit lang in Manchester, bevor es ihn nach London gezogen hat. Die Entscheidung nach Deutschland zu ziehen, war random und hat sich wunderbar ergeben.
Wie würdest du deine Kindheit und dein Heranwachsen in Berlin beschreiben?
LU: Sehr eindrucksvoll, sehr privilegiert und einfach sehr, sehr schön. Ich bin sehr behütet und unbeschwert aufgewachsen und habe meine Kindheit in Berlin in schöner Erinnerung. Der Umzug war extrem cool. Ich bin hier in Charlottenburg aufgewachsen, bin in Dahlem zur Schule gegangen und habe Abitur gemacht. Im Vergleich zu London ist es hier alles sehr schön grün und auch viel sicherer.
Mittlerweile lebst du seit 15 Jahren hier. Ist Berlin deine Heimat?
LU Ja, auf jeden Fall. Absolut, meine ganzen Freund:innen und Familie leben hier.
Beruflich bin ich viel unterwegs und ich freue mich immer sehr, nach Berlin-Charlottenburg zu kommen. Es ist absolut mein Zuhause.
Zurück nach England: Seit Anfang des Jahres gehören die Briten nicht mehr zu EU. Wie hast du die Zeit zwischen Brexit-Referendum im Juni 2016 bis Januar 2021 erlebt?
LU: Nach dem Referendum habe ich lange gehofft, dass der Brexit noch verhindert wird. Es war ein schleichender Prozess und irgendwann war klar, Theresa May kriegt das nicht mehr hin. Ich fand das einfach richtig traurig und habe dann sofort die britische Staatsbürgerschaft beantragt.
Warum war dir das wichtig?
In erster Linie ging es mir darum, weiterhin ohne Einschränkungen in England arbeiten zu können. Das ist jetzt für Europäer:innen nicht mehr so selbstverständlich und einfach wie vorher. Der Brexit ist sehr zu bedauern, weil es die – nach meinem Eindruck – schwache EU per se noch einmal komplett abschwächt, wenn sie ein Gründungsmitglied verliert. Außerdem wird deutlich, wie sehr Kampagnenarbeit ungebildete Schichten beeinflussen kann. Schlimm war auch, dass viele junge Leute, die von den Maßnahmen am meisten betroffen sein werden, nicht abgestimmt haben. Meiner Meinung nach ist die Abstimmung zum Brexitreferendum ein gutes Beispiel dafür, warum es hier in Deutschland keine Bürgerentscheide auf Bundesebene gibt.
„Wenn man woanders aufgewachsen ist, weiß man auch, wie außergewöhnlich frei man hier in Berlin lebt. Das wissen viele gar nicht zu schätzen.“
Was ist der größte Vorteil, in zwei Welten aufzuwachsen?
LU Tatsächlich glaube ich, dass man einfach mehr sieht, verschiedene Perspektiven erlebt und versteht, vieles in Relation zu setzen. Es macht deutlich, es gibt nicht nur diesen einen Weg, sondern mehrere Möglichkeiten und vielleicht lernt man auch, nicht alles so wichtig zu nehmen und weiß, dass Berlin nicht das Zentrum der Welt ist und es noch so viel mehr da draußen gibt. Wenn man woanders aufgewachsen ist, weiß man auch, wie außergewöhnlich frei man hier in Berlin lebt. Das wissen viele gar nicht zu schätzen.
Was liebst du an der englischen Sprache und Kultur und was ist vielleicht typisch britisch an dir?
LU: Ich bin wirklich sehr höflich!
Das ist mir ehrlicherweise sofort positiv aufgefallen.
LU: Dieses Unhöfliche, das hier in Berlin irgendwie das Nonplusultra ist, finde ich unmöglich, sogar ziemlich peinlich irgendwie. Gerade in einer Stadt wie Berlin, die vom Tourismus lebt, müsste doch der Customer Service oberste Priorität haben. Wenn sich zwei fremde Menschen im day to day life treffen und höflich und nicht schroff sind, wenn auch vielleicht oberflächlich miteinander umgehen, haben doch alle eine schönere Zeit. Wir leben in einem so schönen Land und es wäre toll, wenn wir ein bisschen freundlicher miteinander umgehen würden und man dadurch das Gefühl hätte, man achtet aufeinander.
Du hast schon in mehreren Netflix-Produktionen mitgespielt. Sind Produktionen, beziehungsweise Casts und die Gewerke per se diverser angelegt, weil sie auf den Weltmarkt ausgerichtet sind und sich nicht ausschließlich am heimischen deutschen öffentlich-rechtlichen Durchschnittszuschauer orientieren?
LU: Absolut! Also auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich, dass damit auch Druck auf öffentlich-rechtliche oder private Sender ausgeübt wird. Denn wenn du auf dem englischen oder auf dem amerikanischen Markt bestehen willst, kannst du keinen all-white-Cast haben, weil dann halt Fragen gestellt werden, die hier bis letzten Sommer auf jeden Fall nie gestellt worden sind.
Nach welchen Kriterien suchst du deine Rollen aus?
LU: Ich habe mir immer gesagt, ich werde nicht irgendwelche Rollen, die mir qualitativ nicht zusprechen annehmen, nur um als Schauspieler zu arbeiten. Ich wollte immer auf die für mich richtigen Rollen warten und erstaunlicherweise hat sich diese Herangehensweise bisher ausgezahlt. In diesem Jahr läuft meine vierte Netflix Collaboration „How to sell drugs online (fast)“.
Eine klassische Schauspielausbildung hast du nicht absolviert, sondern bist ein klassischer Autodidakt?
LU: Genau und dabei bleibe ich auch. Ich liebe das Spielen. Und anstatt Schauspielunterricht zu nehmen, davor hätte ich sogar ein bisschen Angst, habe ich mich in der Uni für Politikwissenschaften eingeschrieben und hoffe, im nächsten Semester auch wieder in Vorlesungen gehen zu können.
Du bist nicht nur auf der Leinwand zu sehen, sondern stehst auch auf Theaterbühnen. Was reizt dich daran?
LU: Ich glaube, das wahre Schauspiel liegt irgendwo zwischen beiden Bühnen. Als Filmschauspieler besteht die Gefahr, irgendwann nur noch sehr klein, also nur für die Kamera zu spielen. Dass man nur noch für gewisse Einstellungen und Perspektiven spielt und gar nicht mehr für die Menschen im Raum. Im Theater musst du für alle Anwesenden im Raum spielen. Und ich glaube, wenn du das verlierst, verliert man auch so ein Stück von der Quintessenz, die das Schauspiel ausmacht. Deswegen macht mir beides Spaß. Natürlich gibt’s auch nichts niceres, als vor echten Menschen zu spielen und das höchste der Gefühle ist, wenn nach Premieren das Publikum wahrhaftig klatscht.
Nicht nur die Unis, auch die Theaterbühnen waren während der Pandemie geschlossen. Viele Kreativschaffende waren zum Pausieren gezwungen. Wie hast du die Stimmung in der Branche in den vergangenen Monaten erlebt?
LU: Genau zu dem Zeitpunkt, als „Unorthodox“ rauskam, ging die Pandemie los, so dass alle Premieren und Events abgesagt wurden. Als sich abzeichnete, wie erfolgreich die Miniserie sein wird, habe ich dann auch schon wieder gedreht. In der Branche haben nur noch Produktionen mit ganz viel Geld und Planungssicherheit stattgefunden. Alles, was ein bisschen experimentell war oder ein kleineres Budget hatte, wurde einfach ausgesetzt oder ganz gestrichen.
Und auch die Theater wurden geschlossen…
LU: Ja, natürlich. Es war einfach schon krass zu sehen, dass wir in der Lage sind, sehr eifrig, und etwas zynisch ausgedrückt, alles vermeintlich „Unwichtige“ zu streichen, aber vieles, was mit Arbeit im kapitalistischen Sinne zu tun hat, weiterläuft.
Für großen medialen Wirbel sorgte die Kampagne #allesdichtmachen. Namenhafte Schauspieler*innen kritisierten Ende April mit ironisch und satirisch gemeinten Videos die Corona-Politik der Bundesregierung und die Medienberichterstattung zum Thema. War das eine notwendige Aktion?
LU: Nein, absolut nicht notwendig. Wir leben in einem freien Land und jeder und jede kann selbstverständlich sagen und machen, was er oder sie möchte. Aber der Sinn von Satire ist, dass sie witzig ist und das waren die Videos gar nicht. Natürlich gibt es Kritikpunkte an den Maßnahmen, die ich auch nicht alle richtig und gut finde. Aber ich habe auch ein Problem damit, wenn gerade die Schauspieler:innen, die relativ gut arbeiten und viel Geld verdienen –es waren ja ein paar sehr prominente Namen bei der Aktion darunter – so tun, als hätten sie ähnlich viel auszuhalten wie Schauspieler*innen, die in sehr kleinen Wohnungen leben, die Kinder ernähren müssen, die nicht in die Schule gehen. Ich finde es außerdem problematisch, wenn das Selbstverständnis einiger Schauspieler:innen so weit geht, dass sie sich zu öffentlichen Statements hinreißen lassen, obwohl sie von dem Thema keine Ahnung haben. Vielleicht sollten sie das in Zukunft lieber lassen.
Bei der Europameisterschaft gab es Pfiffe aus dem Publikum, weil Spieler sich mit der Black Lives Matter-Bewegung solidarisiert haben. Wo stehen wir ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd?
LU: Die Pfiffe sind ein Beleg dafür, dass es noch Menschen gibt, die ein Problem mit Rassismusgegenmaßnahmen haben. Es ja nicht so, als würde man mit dem symbolischen Kniefall irgendwelche Probleme lösen, aber es ist ein sehr starkes Zeichen auf so einer großen Bühne. Was ich total cool finde! Und man darf nicht vergessen, dass außerhalb unserer Bubble, nicht nur die AfD, sondern auch Teile der CDU-Wählerschaft Probleme mit schwarzen Menschen haben, nur weil sie schwarz sind und meinen, Deutschland ist ein weißes Land und das solle auch so bleiben. Das sind bestimmt gefühlt 15 bis 20 Prozent, die sagen, Deutschland solle so bleiben, wie es ist. Auch wenn es schwer auszuhalten ist, muss man das klipp und klar benennen, dass es diese Menschen gibt und anerkennen, dass auch diese Menschen ein Recht auf ihre Meinung haben und sich selber immer wieder klar positionieren. Ich glaube es gibt nichts Gefährliches, als diese Gruppe immer nur kleinzureden und zu behaupten, es wäre immer nur eine Momentaufnahme, eine nur kurze Reaktion und Stimmungsbarometer auf ein bestimmtes Ereignis. Ich denke, es gibt einfach eine feste Gruppierung mit völkischem Gedankengut in der deutschen Gesellschaft. Aber wiederum auch, dass eine gut funktionierende Gesellschaft eine gewisse Spannung aushalten können muss.
Im aktuellen Bundestagswahlkampf spielen Fragen zur Chancengleichheit oder Rassismus bisher – wenn überhaupt – eine untergeordnete Rolle. Nimmst du das auch so wahr und was sagt das über die politische Debatte aus?
LU: Ja, das stimmt, das nehme ich auch so wahr. Wir haben dieses Jahr eine sehr, sehr besondere Situation, weil alle Parteien außer der CDU und den Grünen um die 10 Prozentmarke herum kämpfen.
Welche Erwartungen oder Forderungen hast du an die Politik?
LU: Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir einem Linksbündnis eine Chance geben, das aber sehr unwahrscheinlich ist. Nichtdestotrotz finde ich, dass in diesem Land, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel gut läuft und es den meisten sehr gut geht und wir in einem tollen Land leben. Was nicht sein darf ist, dass das Einkommen und der Bildungsstand der Eltern darüber entschieden, welche Aufstiegschance ihre Kinder haben. Außerdem bin ich dafür, dass die Hartz-IV-Sätze auf ein menschenwürdiges Niveau angehoben werden. Dabei geht es im Endeffekt wieder um die Kinder, die nichts dafürkönnen, dass ihre Eltern arbeitslos sind und mit einer krass geringen Lebensqualität leben. Und das in einem der reichsten Länder der Welt. Diese Punkte sprechen vor allem linke Parteien an.
Du hast bereits an der Seite von Iris Berben und Katja Riemann gespielt. Was konntest du dir von diesen beiden erfahrenen Schauspielerinnen abgucken?
LU: Mit Katja Riemann habe ich mich persönlich sehr gut verstanden und dabei kapiert, wie schwierig es ist, sich als Frau in dieser männerdominierten Branche über die Jahre hinweg durchzusetzen. Von ihr habe ich außerdem gelernt, dass es sich lohnt, seiner Linie treu zu bleiben, auch wenn man dafür sehr viel Kraft aufwenden muss, weil es ohne anzuecken nicht gehen wird.
Was können wir als nächstes on dir sehen und welche Rollen würden dich reizen?
LU: Als nächstes kommt die Serie How To Sell Drugs Online (Fast)“ raus. Sie läuft schon in der dritten Staffel und ich stoße als neuer Charakter hinzu. Richtig Lust hätte ich momentan, mal etwas richtig Absurdes zu spielen, wie in einer Sci-Fi-Serie beispielsweise.
Schnelle Runde entweder oder.
Also Fish and Chips oder Döner Kebab
Jazz oder Hip-Hop
U-Bahn oder Fahrrad
Theater oder Netflix
WhatsUp oder Signal – Antwort: iMessenger (lacht)
Queen Elisabeth oder Angela Merkel.
Träumst du eigentlich auf englisch oder deutsch? Beides!
Text: Wiebke Dierks
Photograph: Julien Fertl