
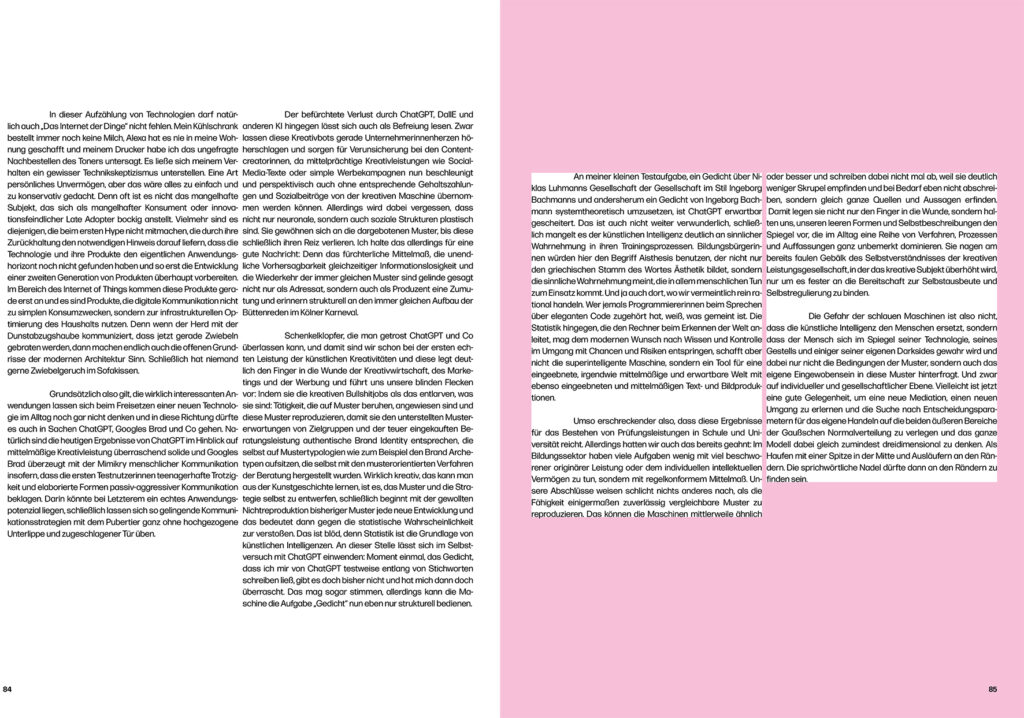
Artificial Intelligence ist gekommen, um zu bleiben und wird – wenn die erste Verwunderung, die ersten Überschätzungen und spekulativen Horrorszenarien abgeklungen sind, – in unserem Alltag neue Muster entstehen lassen. So weit, so gut, so weit, so nüchtern und Nüchternheit tut not, schließlich schwanken wir im medialen Verdauen der neuen Technologie wieder zwischen Begeisterung – Stichwort: Jetzt investieren! – und dystopischer Endzeitstimmung – Stichwort: unsere Jobs!
Dabei ist strukturell zunächst alles wie immer und die mitschnackenden künstlichen Intelligenzen sind erst einmal neue Technologien auf der Suche nach einem realen Anwendungshorizont, in dem sie wirklich Sinn machen, ihr Angebot verlässlicher (ChatGP3) und ihr Auftritt weniger an einen trotzigen Teenager (Google Bard) erinnert. Momentan verlangen sie erst einmal nach Aufmerksamkeit und Kontrolle. Wie jede neue Technologie werden aber auch die schlauen Maschinen auf der Suche nach Funktionen, auf die sie passen könnten, unseren Alltag verändern, denn sie schließen an Bedarfe, Bedürfnisse und Begehrnisse. Allerdings sehr wahrscheinlich anders als eigentlich geplant.
Jede neue Technologie, so viel lässt sich aus der Technikgeschichte lernen, besitzt eine Produktivität anderer Art und mit ‚anderer Art‘ sind hier nicht die Verluste gemeint, die es von jeher bei der Einführung neuer Technologien gibt, sondern das, was sie im Gewebe der sozialen Welt erzeugen und die dunklen Flecken, die sie erhellen. Also all die kleinen und großen Vorannahmen, die mit jeder neuen Technologie erst in ihr Gegenteil verkehrt, dabei großflächig merkwürdige Verhaltensweisen und Nebeneffekte erzeugen, um anschließend im Spiegel der technologischen Folgen neubewertet zu werden.
Bei den frühen Formen von Social Media, etwa Facebook und Co, war es die Auffassung, dass wir alle gerne miteinander kommunizieren, entlang dieser Kommunikationen Zusammenhalt entsteht und uns dies auch im globalen Maßstab näher zusammenbringen würde. Nun ja, wenig später lernten wir, dass ein Großteil unserer Kommunikationen ohne Face-to-face-Kontakt oft auch in Protzerei, mehr oder weniger subtilen Formen des Mobbings, in Fake News und ratzfatz in Extremismus münden kann. Und dass diese Formen nicht auf den digitalen Raum begrenzt sind, sondern in sehr realen Konsequenzen münden können. Allerdings lernten wir mit ihnen auch neue, in der online Welt unverzichtbare Skills. Zum Beispiel die gekonnte Pose fürs Selfie. Die eigentümliche Ästhetik der Fotoalben unsere Eltern und Großeltern im Stil von „Stellt-euch-mal-da-vor-den-Weihnachtsbaum“ finden wir in unseren digitalen Archiven nicht mehr. Wir lernten im Umgang mit Social Media auch handfeste Beobachtungen zweiter Ordnung und verabschiedeten uns von Naivität. Zum Beispiel, dass wir private Dinge wie Kinderfotos besser nicht mit einer anonymen Masse teilen, dass wir auf die Bildhintergründe unserer Fotos achten, wenn wir unseren Aufenthaltsort nicht preisgeben wollen und dass eine öffentlich einsehbare private Adresse plus Urlaubsfoto auf Facebook die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, bei Heimkehr eine leer geräumte Wohnung vorzufinden.
Social Media machte uns auch nicht arbeitslos, sondern ließ im Gegenteil neue Wirtschaftsketten und Berufe entstehen, die sich nach und nach spezialisierten. So absurd sie auch einst erscheinen oder so shady ihr Geschäftsmodel uns anfänglich erschien. Wer hätte vor dreißig Jahren gedacht, dass Social Media Manager oder Influencer mal ein Beruf sein könnte mit dem sich nicht nur der Lebensunterhalt bestreiten lässt, sondern um den herum sich auch noch eine rege Zulieferindustrie entwickelt. Und auch, dass am anderen Ende eines Postings nicht immer ein Mensch sitzt und dass es lohnend sein kann, Botfarmen zu unterhalten haben wir gelernt und hoffentlich auch, wie mit den Kommunikationsangeboten von Botfarmen umzugehen ist.
Selbst die digitale Wende in den 1990er-Jahren in Produkt- und Kommunikationsdesign war gleichermaßen von Hype- und Panikdiskursen begleitet und ist am Ende in eine mittlere Richtung abgebogen. Natürlich können sich an diese Diskurse heute nur noch wir angegrauten Kreativlinge erinnern. Am Ende war auch diese Wende nicht das Ende der Kreativität oder Authentizität und erstrecht nicht das Ende der kreativen Arbeit, sondern der Anfang eines Professionalisierungsschubs, Qualitätssprung und hat jede Menge neuer berufliche Felder geschaffen. Ähnliches gilt auch für den 3-D-Druck – dessen optimistischste Zukunftsbeschreibung vor fünfzehn Jahren noch darin bestand anzunehmen, dass wir uns in Zukunft die Gegenstände des alltäglichen Bedarfs daheim selbst drucken – endet nicht in 3D-Printershops zum Ausdrucken der eigenen Kaffeetassen an jeder Straßenecke.
In dieser Aufzählung von Technologien darf natürlich auch „Das Internet der Dinge“ nicht fehlen. Mein Kühlschrank bestellt immer noch keine Milch, Alexa hat es nie in meine Wohnung geschafft und meinem Drucker habe ich das ungefragte Nachbestellen des Toners untersagt. Es ließe sich meinem Verhalten ein gewisser Technikskeptizismus unterstellen. Eine Art persönliches Unvermögen, aber das wäre alles zu einfach und zu konservativ gedacht. Denn oft ist es nicht das mangelhafte Subjekt, das sich als mangelhafter Konsument oder innovationsfeindlicher Late Adopter bockig anstellt. Vielmehr sind es diejenigen, die beim ersten Hype nicht mitmachen, die durch ihre Zurückhaltung den notwendigen Hinweis darauf liefern, dass die Technologie und ihre Produkte den eigentlichen Anwendungshorizont noch nicht gefunden haben und so erst die Entwicklung einer zweiten Generation von Produkten überhaupt vorbereiten. Im Bereich des Internet of Things kommen diese Produkte gerade erst an und es sind Produkte, die digitale Kommunikation nicht zu simplen Konsumzwecken, sondern zur infrastrukturellen Optimierung des Haushalts nutzen. Denn wenn der Herd mit der Dunstabzugshaube kommuniziert, dass jetzt gerade Zwiebeln gebraten werden, dann machen endlich auch die offenen Grundrisse der modernen Architektur Sinn. Schließlich hat niemand gerne Zwiebelgeruch im Sofakissen.
Grundsätzlich also gilt, die wirklich interessanten Anwendungen lassen sich beim Freisetzen einer neuen Technologie im Alltag noch gar nicht denken und in diese Richtung dürfte es auch in Sachen ChatGPT, Googles Brad und Co gehen. Natürlich sind die heutigen Ergebnisse von ChatGP3 im Hinblick auf mittelmäßige Kreativleistung überraschend solide und Googles Brad überzeugt mit der Mimikry menschlicher Kommunikation insofern, dass die ersten Testnutzerinnen teenagerhafte Trotzigkeit und elaborierte Formen passiv-aggressiver Kommunikation beklagen. Darin könnte bei Letzterem ein echtes Anwendungspotenzial liegen, schließlich lassen sich so gelingende Kommunikationsstrategien mit dem Pubertier ganz ohne hochgezogene Unterlippe und zugeschlagener Tür üben.
Der befürchtete Verlust durch ChatGPT, DallE und anderen KI hingegen lässt sich auch als Befreiung lesen. Zwar lassen diese Kreativbot gerade Unternehmerinnenherzen höherschlagen und sorgen für Verunsicherung bei den Contentcreatorinnen, da mittelprächtige Kreativleistungen wie Social-Media-Texte oder simple Werbekampagnen nun beschleunigt und perspektivisch auch ohne entsprechende Gehaltszahlungen und Sozialbeiträge von der kreativen Maschine übernommen werden können. Allerdings wird dabei vergessen, dass nicht nur neuronale, sondern auch soziale Strukturen plastisch sind. Sie gewöhnen sich an die dargebotenen Muster, bis diese schließlich ihren Reiz verlieren. Ich halte das allerdings für eine gute Nachricht: Denn das fürchterliche Mittelmaß, die unendliche Vorhersagbarkeit gleichzeitiger Informationslosigkeit und die Wiederkehr der immer gleichen Muster sind gelinde gesagt nicht nur als Adressat, sondern auch als Produzent eine Zumutung und erinnern strukturell an den immer gleichen Aufbau der Büttenreden im Kölner Karneval. Schenkelklopfer, die man getrost ChatGPT und Co überlassen kann, und damit sind wir schon bei der ersten echten Leistung der künstlichen Kreativitäten und diese legt deutlich den Finger in die Wunde der Kreativwirtschaft, des Marketings und der Werbung und führt uns unsere blinden Flecken vor: Indem sie die kreativen Bullshitjobs als das entlarven, was sie sind: Tätigkeit, die auf Muster beruhen, angewiesen sind und diese Muster reproduzieren, damit sie den unterstellten Mustererwartungen von Zielgruppen und der teuer eingekauften Beratungsleistung authentische Brand Identity entsprechen, die selbst auf Mustertypologien wie zum Beispiel den Brand Archetypen aufsitzen, die selbst mit den musterorientierten Verfahren der Beratung hergestellt wurden. Wirklich kreativ, das kann man aus der Kunstgeschichte lernen, ist es, das Muster und die Strategie selbst zu entwerfen, schließlich beginnt mit der gewollten Nichtreproduktion bisheriger Muster jede neue Entwicklung und das bedeutet dann gegen die statistische Wahrscheinlichkeit zur verstoßen. Das ist blöd, denn Statistik ist die Grundlage von künstlichen Intelligenzen. An dieser Stelle lässt sich im Selbstversuch mit ChatGPT einwenden: Moment einmal, das Gedicht, dass ich mir von ChatGPT testweise entlang von Stichworten schreiben ließ, gibt es doch bisher nicht und hat mich dann doch überrascht. Das mag sogar stimmen, allerdings kann die Maschine die Aufgabe „Gedicht“ nun eben nur strukturell bedienen. An meiner kleinen Testaufgabe, ein Gedicht über Niklas Luhmanns Gesellschaft der Gesellschaft im Stil Ingeborg Bachmanns und andersherum ein Gedicht von Ingeborg Bachmann systemtheoretisch umzusetzen, ist ChatGPT erwartbar gescheitert. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, schließlich mangelt es der künstlichen Intelligenz deutlich an sinnlicher Wahrnehmung in ihren Trainingsprozessen. Bildungsbürgerinnen würden hier den Begriff Aisthesis benutzen, der nicht nur den griechischen Stamm des Wortes Ästhetik bildet, sondern die sinnliche Wahrnehmung meint, die in allem menschlichen Tun zum Einsatz kommt. Und ja auch dort, wo wir vermeintlich rein rational handeln. Wer jemals Programmiererinnen beim Sprechen über eleganten Code zugehört hat, weiß, was gemeint ist. Die Statistik hingegen, die den Rechner beim Erkennen der Welt anleitet, mag dem modernen Wunsch nach Wissen und Kontrolle im Umgang mit Chancen und Risiken entspringen, schafft aber nicht die superintelligente Maschine, sondern ein Tool für eine eingeebnete, irgendwie mittelmäßige und erwartbare Welt mit ebenso eingeebneten und mittelmäßigen Text- und Bildproduktionen.
Umso erschreckender also, dass diese Ergebnisse für das Bestehen von Prüfungsleistungen in Schule und Universität reicht. Allerdings hatten wir auch das bereits geahnt: Im Bildungssektor haben viele Aufgaben wenig mit viel beschworener originärer Leistung oder dem individuellen intellektuellen Vermögen zu tun, sondern mit regelkonformem Mittelmaß. Unsere Abschlüsse weisen schlicht nichts anderes nach, als die Fähigkeit einigermaßen zuverlässig vergleichbare Muster zu reproduzieren. Das können die Maschinen mittlerweile ähnlich oder besser und schreiben dabei nicht mal ab, weil sie deutlich weniger Skrupel empfinden und bei Bedarf eben nicht abschreiben, sondern gleich ganze Quellen und Aussagen erfinden. Damit legen sie nicht nur den Finger in die Wunde, sondern halten uns, unseren leeren Formen und Selbstbeschreibungen den Spiegel vor, die im Alltag eine Reihe von Verfahren, Prozessen und Auffassungen ganz unbemerkt dominieren. Sie nagen am bereits faulen Gebälk des Selbstverständnisses der kreativen Leistungsgesellschaft, in der das kreative Subjekt überhöht wird, nur um es fester an die Bereitschaft zur Selbstausbeute und Selbstregulierung zu binden. Die Gefahr der schlauen Maschinen ist also nicht, dass die künstliche Intelligenz den Menschen ersetzt, sondern dass der Mensch sich im Spiegel seiner Technologie, seines Gestells und einiger seiner eigenen Darksides gewahr wird und dabei nur nicht die Bedingungen der Muster, sondern auch das eigene Eingewobensein in diese Muster hinterfragt. Und zwar auf individueller und gesellschaftlicher Ebene. Vielleicht ist jetzt eine gute Gelegenheit, um eine neue Mediation, einen neuen Umgang zu erlernen und die Suche nach Entscheidungsparametern für das eigene Handeln auf die beiden äußeren Bereiche der Gaußschen Normalverteilung zu verlegen und das ganze Modell dabei gleich zumindest dreidimensional zu denken. Als Haufen mit einer Spitze in der Mitte und Ausläufern an den Rändern. Die sprichwörtliche Nadel dürfte dann an den Rändern zu finden sein.
Text: Sandra Groll